Ordnung und* Chaos: stimuliert Phantasie und Kreativität.
Ordnung or** Chaos: blockiert Phantasie und Kreativität, erlauben einigen grenzenlose Macht zu entwickeln, um in das Leben anderer einzugreifen.
* und: das eine durchdringt das andere.
** oder: das eine schließt das andere aus.
Dieser Tractatus bietet ein neues, oder lange vergessenes Sprachspiel an. Er tut dies nicht mittels Definitionen oder Erklärungen sondern durch Zeigen, so als würden Ideen ausgesprochen und gleichzeitig auf sie gezeigt. Er lädt Beobachter dazu ein, hauptsächlich durch Metaphern, neue Arten des Sehens (Verstehens) zu erkunden sowie neue Arten Wünsche und Interaktionen auszudrücken.
Die Beschreibung sämtlicher Phänomene als Prozesse oder Netzwerke mag uns mit Leichtigkeit einleuchten. (Vergegenwärtigen Sie sich etwa Phänomene wie die Bewegung eines Körperteils, die Explosion eines Sterns, die „Kollisionen” von subatomaren „Partikeln”, den „Anfang” des „Universums” sowie dessen anschließende Transformationen etc.).
Dass ein geschlossenes Netzwerk von Prozessen sich selbst als Beobachter einer Umwelt identifizieren kann, welche durch eben diese Unterscheidung selbst hervorgebracht wurde, mag uns weniger leicht verständlich erscheinen. Vergegenwärtigen Sie sich weiterhin: (1) dass die unterschiedene Umwelt den Beobachter (das geschlossene Netzwerk von Prozessen) beinhaltet und (2) dass aus Sicht des Beobachters diese und weitere Unterscheidungen, die aus der Interaktion des Beobachters und der Umwelt hervorgehen, sowohl logisch und paradox erscheinen. In anderen Worten (paradoxerweise) durchdringen sich für den Beobachter alle Möglichkeiten gegenseitig (zum Beispiel existieren und nicht existieren, drinnen und draußen, rot und blau und grün und... etc.) und (logischerweise) unterscheiden sich die Möglichkeiten für den Beobachter voneinander (existieren oder nicht existieren, drinnen oder draußen, rot oder blau oder grün oder... etc.).
Lebende Organismen, mit oder ohne Nervensystem, stellen
Beispiele geschlossener Netzwerke von Prozessen dar. Ein Nervensystem, selbst ein
Netzwerk geschlossener Prozesse, interagiert mit seiner Umwelt durch geschlossene
Netzwerke von Prozessen, die sowohl seine sensorischen Oberflächen als auch
seine effektorischen Oberflächen involvieren. Das Nervensystem interagiert
daher mit seiner Umwelt (paradoxerweise) in und außerhalb seiner selbst
und (logischerweise) in oder außerhalb seiner selbst.
Weitgehend durch ihre Biologie bestimmt, unterscheiden ein oder mehrere
Beobachter, logisch denkend, eine Welt „dort draußen”, die aus
Objekten und Ereignissen besteht. Mit diesen Objekten und Ereignissen assoziieren
sie (durch weitere Unterscheidungen) spezifische Möglichkeiten, als Resultat
wahrnehmerischer und anderer Einschränkungen sowie von Versuchen sozial zu
interagieren. Doch diese Versuche beinhalten Schritte hin zu Trivialität und weg
vom Denken in Paradoxen. Soziales Wissen, sei es „objektiv” oder
„subjektiv”, so wie es von Logikern, Mathematikern, Naturwissenschaftlern,
Technologen und anderen betrieben wird, ist keine Ausnahme. Ein Beobachter mag
solche Versuche nichtsdestotrotz solange wertschätzen wie sie zu Konversation
führen und somit Trivialisierung (Instruktion) des einen durch den anderen
oder der Mehrheit durch eine Minderheit vermeiden.
Zwei oder mehrere individuelle Beobachter können
eine gemeinsame Welt „dort draußen” nicht unterscheiden, es sei
denn dass geeignete Anzeichen sie davon überzeugen. Von solchen Anzeichen
ausgehend können menschliche Beobachter durch logisches Denken
Schlussfolgerungen über die Welt „dort draußen” ziehen, die
nicht standhalten werden bis andere Anzeichen sie untermauern und somit die
ursprüngliche Unterscheidung einer Welt „dort draußen”
bestätigen. Da neue Anzeichen alten widersprechen können, findet dieser
Prozess (Anzeichen, Schlussfolgerungen, neue Anzeichen, neue Schlussfolgerungen)
kein Ende. Er kann sogar die ursprüngliche Unterscheidung einer Welt
„dort draußen” in Frage stellen, was wiederum logisches Denken
selbst in Frage stellen und stattdessen paradoxes Denken nahelegen kann.
Kein Beobachter „löst” oder „erklärt” Paradoxe
ohne dabei Verluste hinnehmen zu müssen. Diese Sicht scheint, wie im
Tractatus gezeigt wird, denjenigen Gesellschaften essenziell zugrunde zu liegen,
die Menschen durch Bildung und Kunst und Philosophie entwickeln sollten.
Der Tractatus sagt nicht, lehrt nicht und erklärt nicht was zu lehren sei,
doch er zeigt Bildung so als deute er dabei mit dem Finger darauf. Er zeichnet
auch die Ursprünge dieser anscheinend empörenden Aussagen nach bis
hin zur Quelle aller Propositionen: die paradoxe Essenz des Beobachters.
Wenn Menschen nicht ihren selbstgemachten Unzulänglichkeiten zum Opfer fallen,
dann sollten die Folgen ihnen helfen sich selbst und die Konsequenzen
ausschließlich logischen Denkens, wie es von Logikern, Mathematikern,
Naturwissenschaftlern, Technologen und anderen betrieben wird zu erkennen
(verstehen). Auf der Suche nach Wahrheit, als suchten sie nach einem Gott,
übersetzen sie alles in ihre eigene Sprache und verfehlen dabei aufs
Gründlichste den Sinn. Diejenigen, die die genannten Disziplinen praktizieren
vergessen oder bekämpfen schnell ihren paradoxen Ursprung, hauptsächlich
weil sie sich für „besser gestellt” und/oder „zufrieden”
halten. Diejenigen, die glauben werden schnell diesen Status erreichen und
logisches Denken befürworten, einfordern oder sich ihn anpassen, ohne
Widerspruch oder Paradoxe, und somit einen status quo erzwingen.
Von Logik zu Paradoxen
Vergegenwärtigen Sie sich eine Aneinanderreihung von Wörtern (einen
Satz) und nennen Sie sie eine Proposition (eine Aussage), die von einem oder
mehreren Beobachtern erfunden wurde, um etwas in einem gegebenem Kontext
festzustellen.
Propositionen können für unterschiedliche Gruppen, bestehend aus einem oder
mehreren Beobachtern, unterschiedliche Bedeutungen haben.
Eine Gruppe von Beobachtern kann durch paradoxes Denken vorläufige gemeinsame
Bedeutungen für Propositionen durch die Sprachspiele finden, die ihre Formen
ihres Lebens bestimmen.
Eine Gruppe von Beobachtern kann durch logisches Denken herausfinden, dass einige
Propositionen nicht auf sich selbst referieren und dass ein Beobachter oder eine
Gruppe von Beobachtern diesen Propositionen logische Werte (z.B. in einer
zweiwertigen Logik: wahr, falsch) zuweisen und festlegen muss. Andere Beobachter
mögen damit nicht übereinstimmen und andere Werte mit Argumenten
verteidigen.
Andere Propositionen referieren auf sich selbst (selbstreferenzielle Propositionen)
und bestimmen somit ihre eigenen logischen Werte, z.B., L:
„Proposition L hat jetzt und hier den Wert wahr”. Ein oder mehrere
Beobachter können wählen und L entweder einen
logischen Wert (wahr, falsch) zuweisen, und da L sich
auf sich selbst bezieht, gestattet es keine Argumente die diese Wahl bestätigen
oder in Frage stellen.
Einige selbstreferenzielle Propositionen, wie etwa die Proposition
„P: Proposition P hat jetzt und hier den Wert falsch”,
bestimmen ihren eigenen „logischen Wert” als „wahr und falsch”
und verhindern somit dass sich der Beobachter für wahr oder falsch entscheidet.
Wenn ein oder mehrere Beobachter, logisch denkend, annehmen, diese Proposition habe
jetzt den Wert wahr, dann müssen sie, dieser Annahme folgend, bald akzeptieren,
dass ihr Wert falsch ist. Wenn sie annehmen der Wert der Proposition sei falsch,
dann müssen sie ihn bald als wahr akzeptieren und so weiter. Für diese
Beobachter oszillieren die Werte: wahr, falsch, wahr, falsch... wenn sie versuchen
einen Wert zu bestimmen. Nennen Sie diese Proposition ein Paradox.
Unglücklicherweise vergessen viele Autoren, die über Paradoxe schreiben
Selbstreferenz und das gegenseitige Durchdringen unterschiedlicher Möglichkeiten
als essenzielle Aspekte von Paradoxen. Dies hat die bedauerliche Folge, dass viele
Rätsel, Puzzles und Knobelspiele etc... für Paradoxe gehalten werden.
Das Paradox erlaubt dem Beobachter nicht, der Proposition einen Wert „wahr”
oder „falsch” zuzuweisen, es sei denn als Teil einer Oszillation, wodurch
der Beobachter eingeladen wird, paradoxes Denken in Betracht zu ziehen und beide
Werte einander durchdringen zu lassen (sämtliche Möglichkeiten in diesem
Fall) zu „wahr und falsch”.
Logisch denkend kann der Beobachter lediglich beide Werte in einer Zeit oder in einem
Raum abwechselnd in Betracht ziehen in Folge des Versuchs des Beobachters das Paradox
von einer logischen Perspektive aus zu betrachten.
Paradox denkend, lässt der Beobachter „wahr” oder „falsch”
einander durchdringen zu „wahr” und „falsch”, was zu einer
paradoxen Perspektive ohne Zeit, Raum und ohne Oszillation führt.
Mit paradoxem Denken lässt der Beobachter jedoch ohne Konflikt alle
Möglichkeiten einander durchdringen. Daher lässt der Beobachter mit paradoxem
Denken auch paradoxes oder logisches Denken einander zu paradoxem und
logischem Denken durchdringen. Somit kann der Beobachter, paradox denkend, auch
provisorische Unterscheidungen in Raum und Zeit fällen.
In einer selbstreferenziellen Schleife von Propositionen wie der folgenden,
abgeleitet von der oben genannten L, werden alle
Propositionen, in Abhängigkeit von dem was der Beobachter für eine
der Propositionen, z.B. L1, wählt, entweder den Wert „wahr” oder
den Wert „falsch” haben (und keine Oszillation entsteht):
t1 |
t2 ... |
|||
L1: „L2 hat jetzt
und hier den Wert wahr.” |
W(F) |
W(F)… |
||
L2: „L3 hat jetzt
und hier den Wert wahr.” |
W(F) |
W(F)… |
||
Ln: „L1 hat jetzt
und hier den Wert wahr.” |
W(F) |
W(F) |
||
Eine selbstreferenzielle Schleife wie die folgende, abgeleitet von der oben genannten Proposition P, wird dem Beobachter nicht erlauben, ihren enthaltenen Propositionen Werte zuzuweisen, da ihre Werte logisch oszillieren und sich für den Beobachter wie zuvor einander paradox durchdringen werden (beachten Sie dass nun, da der Beobachter logisch denkend den Wert jeder Proposition zuweist, die Werte die Schleife aus Propositionen durchlaufen und somit die Oszillation von Werten etwas komplexer gestaltet als hier gezeigt):
t1 |
t2 |
t3 ... |
|||
P1: „P2 hat jetzt
und hier den Wert wahr.” |
W |
F |
W ... |
||
P2: „P3 hat jetzt
und hier den Wert wahr.” |
W |
F |
W ... |
||
Pn: „P1 hat jetzt
und hier den Wert falsch.” |
W |
F |
W ... |
||
So wie Proposition P
legt diese Schleife von Propositionen dem Beobachter paradoxes Denken nahe.
Wenn ein Beobachter einen schmalen Streifen Papier nimmt und dessen Enden
aneinander klebt, dann formt er einen Ring mit zwei Seiten (innen und außen)
und zwei Kanten (rechts und links oder oben und unten, je nach dem wie der
Beobachter den Ring hält). Nimmt er an, dass je eine der Seiten (oder
Kanten) des Rings mit einem Wert (W, F) korrespondiert, kann der Beobachter
den ganzen Ring als Metapher sehen für die Schleife aus Propositionen,
die von L abgeleitet wurde.
Wenn der Beobachter ein Ende des Papierstreifens um 180 Grad verdreht bevor
er es an das andere Ende klebt, so formt er ein Möbius-Band mit einer
Seite und einer Kante (siehe Ring und Möbius-Band im folgenden Abschnitt).
Dieses Band entspricht der paradoxen, von P
abgeleiteten Schleife aus Propositionen, in der sich, aus Sicht des Beobachters
der die Schleife durchläuft, logische Werte abwechseln (in einer Zeit und
einem Raum) und zwei paradoxe Werte sich in einen durchdringen (keine Zeit,
kein Raum). Ebenso wechselt das Band für den Beobachter der entlang des
Bandes läuft, logisch zwischen zwei Seiten (in einem Raum und einer Zeit)
und beide Seiten durchdringen einander paradox in eine einzige (keine Zeit,
kein Raum). Gleichsam wechseln logisch beide Kanten (in einer Zeit, in einem
Raum) und durchdringen einander paradox in eine einzige (keine Zeit, kein Raum).
Beachten Sie, dass Proposition n mit der Verdrehung korrespondiert und dass
jede ungerade Anzahl von Verdrehungen das Paradox aufrecht erhält,
während jede gerade Anzahl von Verdrehungen es zerstört indem sie
eine Unterscheidung einführt.
Logische und paradoxe Toroide
Wenn ein Beobachter anstatt eines Bandes eine Röhre mit polygonalem Querschnitt
hat, die in sich geschlossen eine toroide Form mit 3, 4, 5... oder n Seiten hat,
und wenn jede Seite eine Möglichkeit repräsentiert (z.B. einen logischen
Wert in einer Logik mit multiplen Werten oder eine Komponente in einem geschlossenen
Netzwerk aus Prozessen und Komponenten), so hat der Beobachter eine logische toroide
Form aus der er mit einer geeigneten Verdrehung (360/3 Grad = 120 Grad bei 3 Seiten,
360/4 Grad = 90 Grad bei 4 Seiten, 360/n Grad bei n Seiten (n Möglichkeiten))
einen paradoxen Toroid (eine Seite, eine Kante) formen kann.
Ring und Möbius-Band: (2 Seiten <=> 1 Seite, 2 Kanten <=> 1 Kante) |
 |
Logische and paradoxe Toroide: (3 Seiten <=> 1 Seite; 3 Kanten <=> 1 Kante) |
 |
Logische and paradoxe Toroide: (4 Seiten <=> 1 Seite; 4 Kanten <=> 1 Kante) |
 |
Aus Sicht des Beobachters, der die entstandene Seite der Länge nach verfolgt, wechselt der paradoxe Toroid zwischen n Seiten in einem Raum und in einer Zeit und gleichzeitig durchdringen sich die n Seiten paradox zu einer einzigen Seite, wodurch Raum und Zeit eliminiert werden. Jedes Mal wenn der logisch denkende Beobachter nach einer Umrundung des paradoxen Toroids wieder am Ausgangspunkt ankommt, wird der Beobachter auf einer anderen (und, paradox, derselben) Seite stehen. Der paradoxe Toroid legt dem Beobachter auch paradoxes Denken nahe.
Vergegenwärtigen Sie sich nun dass ein logischer
Toroid als Metapher für eine Menge von Komponenten (die Seiten des Toroids),
die sich nicht verändern (kein Prozess, keine Aktivität), die statischen
Möglichkeiten nicht-lebendiger Dinge repräsentieren können.
Als eine Metapher für eine Menge sich (durch Prozess) ineinander
verändernder Komponenten repräsentiert ein paradoxer Toroid jedoch
die dynamische Stabilität, die im Herzen aller lebenden Organismen und
im Herzen des Nervensystems liegt.
Logisch denkend sehen geschlossene Netzwerke sich verändernder Komponenten folgendermaßen aus (für 2 und 3 Komponenten):
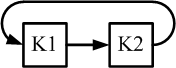 |
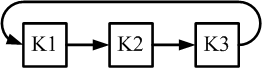 |
Die Pfeile repräsentieren die Prozesse und die Zeiten und Räume, die aus
der gewählten logischen Perspektive resultieren.
Paradox denkend sehen dieselben Netzwerke aus wie folgt:
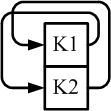 |
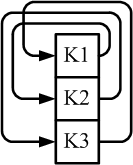 |
Die Pfeile repräsentieren nun Komponenten, die einander durchdringen,
Selbstreferenz und Verdrehung (die am besten durch den korrespondierenden
Toroid verdeutlicht wird). Weder Zeit noch Raum resultieren von dieser
Perspektive.
Von
Paradoxen zu Logik
Solange wir es nicht besser wissen macht es Sinn anzunehmen dass menschliche
Kinder und ihre Nervensysteme, wenn sie auf die Welt kommen und Teil einer
Gesellschaft werden, ihre Umgebungen, sich selbst und ihre Emotionen und
Empfindungen beobachten (explorieren), ohne dabei von den Zwängen eines
logischen Bezugsrahmens eingeschränkt zu werden.
Vergegenwärtigen Sie sich, dieser Annahme folgend, Beobachtung (Wahrnehmung)
als Resultat einer Aktivität geschlossener Schleifen aus Prozessen die, sensorische
und effektorische Oberflächen durchquerend, innerhalb und außerhalb
des Nervensystems liegen. Da diese Aktivität sämtliche Möglichkeiten
einschließt, müssen diese Schleifen den oben diskutierten paradoxen
Schleifen ähneln und die Rolle paradoxer Kontexte spielen, in denen
uneingeschränkte kindliche Beobachter, paradox denkend (logisches Denken
setzt gerade erst ein), provisorische Unterscheidungen treffen.
Ein bescheidenes Maß an Instruktion und Training kann diese Beobachter
dazu zwingen, nur einen Teil ihrer paradoxen Toroide (ein Teil den jeder Beobachter
mit Teilen der Toroide anderer Beobachter in Übereinstimmung bringen kann)
in Betracht zu ziehen, so dass ausschließlich logisches Denken entstehen kann.
Weitreichende strenge Instruktion und Training hingegen können den Beobachter
zwingen die Verdrehungen ihrer paradoxen Toroide zurückzudrehen (um logische
Toride daraus zu machen). Anders als im ersten Fall, der sich als revidierbar
herausstellen kann und zu einen halbwegs flexiblen Beobachter führen kann,
kann sich der zweite Fall als nicht revidierbar herausstellen und zu einem
rigiden Beobachter führen, der ausschließlich logisches Denken in
Betracht zieht.
Die meisten Beobachter erliegen diesen Zwangs-Methoden und geben die paradoxe
Sicht (den gesamten paradoxen Toroid) auf. Dies offenbart die Essenz und den
Ursprung allen logischen Denkens: eine soziale Bequemlichkeit, extrahiert aus
einer paradoxen Umwelt. Dieses Extrahieren reduziert jedoch von vorneherein die
Möglichkeiten (die verfügbare Auswahl) für diese Beobachter.
Logisches Denken
Logiker und Mathematiker haben (unter größten Anstrengungen, brillant)
den gesamten Apparat der Logik eben diesen paradoxen Schleifen entrissen und
abgerungen, auf dass dieser Apparat so viele Logiker und Mathematiker wie
möglich entzücke. Dieses Entreißen und Abringen reduziert, wie
zuvor besprochen, von vornherein die gegebenen Möglichkeiten (die
verfügbare Auswahl). Dasselbe gilt für Wissenschaft und ihre Anwendungen
sowie für jede Aktivität, in der die Beobachter versuchen, rein logisch zu
denken.
Trotz allem was sie ermöglichen - hauptsächlich das gemeinsame Erbauen und
Zerstören von Dingen - berauben rein logisches Denken und davon abgeleitete
„logische” Sprache Menschen ihrer Weisheit. Und weil unterschiedliche
Gruppen von Menschen oft nicht dasselbe logische Denken teilen, haben rein logisches
Denken und davon abgeleitete „logische” Sprache auch menschliche
Irrationalität stimuliert, was durch exzessive und unnötige
Ungleichverteilungen von Reichtum und Macht verschlimmert wird.
Beobachter, die ausschließlich logisch denken, waren, wie die Geschichte
von Logik und Mathematik belegt, immer schon bemüht, das logische Denken
von seinem paradoxen Ursprung zu distanzieren. Diese Geschichte zeigt eine
Vielzahl von Ablegern dieser Disziplinen von denen sich die meisten, wenn nicht
alle, der Ausmerzung oder der Isolation von Paradoxen verschrieben haben. Dies
ist ein Beleg dafür, dass den in ihnen konzentrierten Disziplinen, in ihren
eigenen Sprachen und deren wachsender Abstraktion, die philosophische Richtung
fehlt, was sie zunehmend ungeeignet macht einen Beitrag zu einer besseren
menschlichen Gesellschaft zu leisten.
Ein
Beispiel
Viele paradoxe Schleifen haben nützliche oder nutzlose Anwendungen inspiriert,
wie etwa den logischen Invertierer mit Feedback der als Oszillator benutzt wird
(z.B. als Taktgeber im Herzen digitaler Computer), oder der elektromagnetische
Summer in elektrischen Türklingeln, oder das Paradox des Lügners und den
vielen anderen, die viele Logiker und Mathematiker inspiriert und geplagt
haben. Das im Folgenden präsentierte Beispiel legt die Erkenntnisse nahe,
die Paradoxe der Logik, der Mathematik und den Naturwissenschaften vermitteln
können, wenn Menschen sie als Teil des Denkens zuließen; als würden
Menschen Unruhestiftern zuhören anstatt sie zum Schweigen zu bringen.
Wenn ein Beobachter nachts einen Raum betritt, dann wird der Beobachter
normalerweise ein elektrisches Licht einschalten indem er einen Schalter
nahe der Tür betätigt. Unten folgt ein Diagramm des entsprechenden
elektrischen Stromkreises. SQ bedeutet eine Spannungsquelle und L bedeutet ein Licht. Der Schalter SCH ermöglicht des Fluss von
elektrischem Strom (Licht an) wenn er geschlossen ist und unterbricht des
Strom (Licht aus) wenn er geöffnet ist.
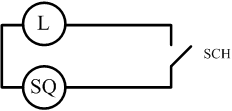
Wenn der Raum mehrere Türen hat, möchte
der Beobachter gerne an jeder Tür einen Schalter vorfinden, so dass jeder
der Schalter dasselbe Licht ein- oder ausschalten kann.
Ein paradoxer Ansatz liefert eine interessante Lösung für dieses
Problem mit vielen Möglichkeiten und Bedeutungen. Modifizieren Sie den
Schaltkreis wie folgt:
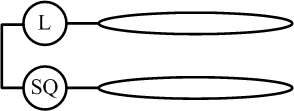
Anstelle des Schalters weist der Schaltkreis nun zwei Ringe aus elektrisch leitendem Draht auf. Stellen Sie sich diese beiden Ringe vor als die beiden Kanten des oben besprochenen Rings aus Papier. Wenn es dem Beobachter gelingt, dieses Band zu verdrehen und so ein Möbius-Band zu formen, so bilden die beiden Ringe eine ununterbrochene Verbindung. Sie schließen somit den Stromkreis und das Licht ist eingeschaltet. Der Beobachter kann dies wie im Folgenden dargestellt mit einem sogenannten Kreuzschalter (oder Polwender) erreichen:
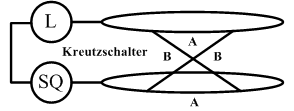
Befindet sich der Schalter in Position A (Verbindungen A geschlossen, Verbindungen B offen), so bleiben die beiden Drahtringe voneinander isoliert (Licht aus). Befindet sich der Schalter in Position B (Verbindungen A offen, Verbindungen B geschlossen), so überkreuzen (verdrehen) sich die beiden Drahtringe miteinander und erlauben einen Stromfluss. Das Licht ist nun eingeschaltet. Der Beobachter kann entlang der beiden Drahtringe so viele dieser Schalter installieren wie er beliebt. Wie in der paradoxen Schleife aus Propositionen schaltet nur eine ungerade Anzahl von Schaltern in Position B (Verdrehung) das Licht ein. Beachten Sie, dass die Arbeitsweise des Schaltkreises Logik und Paradox, Unterscheidung und die Abwesenheit von Unterscheidung beinhaltet. Wenn der Beobachter einen Schalter neben jeder Tür platziert und sie verdrahtet wie hier gezeigt, dann kann er von jeder Tür aus das Licht ein- oder ausschalten.
Darüber hinaus resultieren in Abhängigkeit der Platzierung von Stromquelle und Lichtquelle zwischen den Schaltern entlang der Drahtringe unterschiedliche Operationen aus den Schalterstellungen.
(Ich habe diesen Schaltkreis mit fünf
Kreuzschaltern gebaut und er verhält sich wie ich ihn beschrieben habe.)
Eine Metapher
Stellen Sie sich ein Netzwerk aus sagen wir
einhundert Knoten in einer 2D (zweidimensionalen) Matrix von 10 mal 10
horizontal und vertikal verbundenen Elementen vor (eine 2D Vernetzung
von Knoten). Platzieren Sie an jedem Knoten einen Oszillator und machen
Sie die Oszillation jedes Knotens beobachtbar durch eine Lichtquelle, die
der Knoten in einer gegebenen Frequenz ein- (rot) und ausschaltet (weiß).
(Dies ist in der oberen Hälfte der unten folgenden Grafik dargestellt).
Ein einfacher Oszillator besteht aus einem Invertierer in einer paradoxen
Schleife (einer Schleife mit einer Verdrehung wie etwa ein Möbius-Band).
So wie ein Paradox entwickelt sich die Oszillation in einer Zeit und in einem
Raum basierend auf der Ansicht eines Beobachters, der den Oszillator aus einer
logischen Perspektive betrachtet. (Viele Konfigurationen von Elementen in einer
wiedereintretenden Schleife können unterschiedliche Arten von Oszillatoren
von unterschiedlicher Komplexität hervorbringen, wie etwa elektrische,
mechanische, optische, biologische etc. Oszillatoren.). In dem Netzwerk
oszillieren alle Knoten in etwa mit derselben Frequenz. Schaltet ein Knoten
seine Lichtquelle aus, so sendet er ein Stimulations-Signal an seine vier
Nachbarn (oben, unten, rechts und links, wobei Knoten an den äußeren
Kanten der Matrix mit korrespondierenden Knoten an der jeweils
gegenüberliegenden Kante verbunden sind), mit dem Resultat dass diese
ihre Lichtquellen einschalten. Diese von dem Knoten ausgehende Aktivität
synchronisiert das gesamte Netzwerk, so dass es oszilliert indem es (vertikal
und horizontal) abwechselnde Lichtquellen gemeinsam (zu Zeitpunkten t1, t2,
t3, t4, t5, t6...) ein- und ausschaltet. Es weist darüber hinaus zahllose
paradoxe Schleifen auf. Die Verbindung der gegenüberliegenden
äußeren Kanten der Matrix, sei sie baulich oder rein infrastrukturell
ausgeführt, verbindet eine gerade Reihe (Spalte) mit einer ungeraden
und eine ungerade mit einer geraden. (Ich habe dieses Netzwerk gebaut und es
verhält sich wie beschrieben.)
Die dynamische Stabilität der Aktivität des Netzwerks,
die eindeutig komplexer ist als die der in ihm enthaltenen einzelnen Knoten,
liefert eine Vielzahl paradoxer Kontexte (alle Möglichkeiten) in denen
der Beobachter zwischen gleichzeitig auftretenden Alternativen wählen
(unterscheiden) kann:
(Wenn die Anzahl der gewählten Lichtquellen für jede Gruppe wächst, dann wächst die Anzahl der möglichen, vom Beobachter durch das Auswählen benachbarter Lichtquellen formbarer Muster noch mehr. Dies passiert sogar in einem bescheiden dimensionierten Netzwerk wie dem hier beschriebenen. Beachten Sie, dass der Beobachter nicht sämtlichen möglichen Mustern folgen kann, wodurch ihm unvermeidbar alle Muster, denen er nicht folgt, entgehen, da jeder Beobachter nur soundso viel von seiner Umwelt Aufmerksamkeit schenken kann und den Rest verpassen muss.)
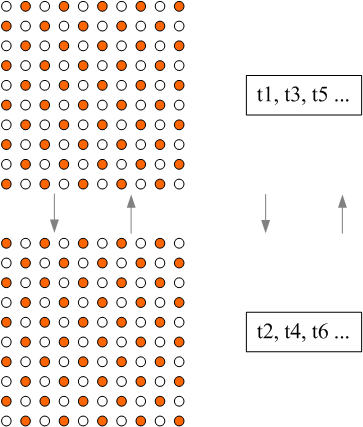 |
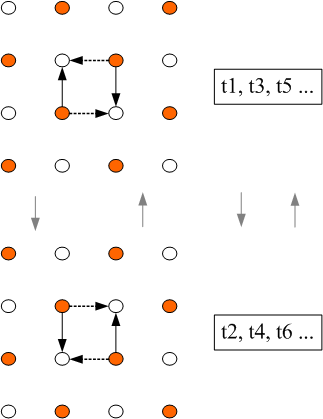 |
Die Auswahlen des Beobachters haben keinen Einfluss
auf die Oszillation des Netzwerks, doch ohne die Aktivität des Netzwerks
hätte der Beobachter nichts auszuwählen. Andererseits macht die
Aktivität des Netzwerks ohne einen Beobachter keinen Sinn.
Durch die Ergänzung des Netzwerks mit Lichtsensoren könnte ein (dem
Netzwerk) externes Licht die dynamische Stabilität der Netzwerkaktivität
beeinflussen, so dass einige Nachbarn sich nicht wie erwartet einschalten oder
umgekehrt. Hierdurch verändert sich die Anzahl der Auswahlen, die dem
Beobachter zur Verfügung stehen. Dies zeigt, dass das Netzwerk jede beliebige
Form haben kann: regelmäßig, wie hier beschrieben, oder irregulär.
Da das Netzwerk selbst Licht erzeugt, können einige Lichtquellen als
Effektoren agieren und mit einem anderen oder dem eigenen Netzwerk interagieren
(z.B. mit einem Spiegel).
Für einen Beobachter können einige der Lampen Effektor-Oberflächen,
und einige Lichtsensoren können Sensor-Oberflächen des Netzwerks
repräsentieren. In einem solchen Netzwerk führt jede Aktivität
irgendwo im Netzwerk zu weiterer Aktivität anderswo im Netzwerk, die
„externe Umwelt” des Netzwerks inbegriffen.
Eine externe Stimulation (z.B. Licht), die die Aktivität einiger Lichtquellen
unterdrückt, kann zur teilweisen oder vollständigen Isolation anderer
Lichtquellen führen. Diese werden weiterhin in Isolation oszillieren, doch
die Aktivität der Netzwerks wird desintegrieren und aufhören als Einheit
zu oszillieren.
Lassen Sie uns nun das Netzwerk oszillierender Lichtquellen als Gesellschaft
individueller Organismen (Lichtquellen oder Gruppen von Lichtquellen) beobachten,
die mit ihren unmittelbaren Nachbarn interagieren. Unter bestimmten Umständen
können diese Interaktionen mit denen einer tatsächlichen Gesellschaft
korrespondieren, wie z.B. einem Ameisenhügel, einem Bienenstock oder einer
Gruppe von Menschen. Beachten Sie, dass für einen Beobachter, der vom
Funktionieren dieser „Gesellschaften” nicht beeinflusst wird, diese
„Gesellschaften” keinen Sinn machen außer als oszillierende
Netzwerke, die schlicht oszillieren wie die oben beschriebene Matrix von
Lichtquellen (egal wie Komplex die Oszillation ist).
Stellen sie sich einen Besucher in einem fremden Land vor, in dem die Einwohner
eine Sprache sprechen, die der Besucher nicht versteht und in dem die Einwohner
nicht die Sprache des Besuchers verstehen. Eine Zeit lang könnte der
Beobachter nicht mit den Menschen des Landes interagieren. Der Besucher verhielte
sich also nur als Beobachter der Menschen dort, und umgekehrt, solange keine der
Parteien die andere als störend empfindet. Die Gesellschaften oder Gruppen,
die der Besucher antreffen könnte, werden ihm solange als schlicht
oszillierende Netzwerke erscheinen, bis der Besucher die Sprache lernt und der
Oszillation (dem Tanz) beitritt.
Die Aktivität dieser oszillierenden Netzwerke könnte örtliche
Beschädigungen erleiden (einige Knoten könnten aufhören zu
oszillieren, Stimulations- oder Unterdrückungs-Signale könnten
blockiert werden etc.), doch das Netzwerk insgesamt fährt in seinem Tanz
fort und lässt dynamische Stabilität und Instabilität einander
durchdringen, wodurch das Leben der Gruppe oder der Gesellschaft und ihrer
Mitglieder bereichert wird. Durch weitreichenden Schaden könnte die
Aktivität des Netzwerkes desintegrieren.
Beachten Sie, dass sich die Aktivität (Oszillation) im Netzwerk insgesamt
selbst aufrecht erhält, da jeder Aktivität irgendwo im Netzwerk zu
weiterer Aktivität (integriert, synchronisiert) anderswo im Netzwerk
führt - Aktivität, die durch viele mögliche paradoxe
Rückkopplungs-Schleifen zu der ursprünglich betrachteten Aktivität
wiedereintritt. (Ein Kreis, eine Kugel, mit Mittelpunkt überall und seinem
Umfang, Oberfläche nirgendwo).
Es sollte durch das oben Diskutierte klar werden,
dass die ursprüngliche 2D-Vernetzung von Knoten in eine multidimensionale
Vernetzung von Knoten wachsen könnte, dass die Aktivität von Knoten
wesentlich komplexer werden können als das Ein- und Ausschalten einer
Lichtquelle und dass die Signale zwischen den Knoten ebenso an Komplexität
zunehmen können. Lebende Organismen, zum Beispiel, interagieren durch
eine Vielzahl von Signalträgern und komplexer Signale: elektrochemische,
chemische, Licht, Ton, Tanz etc. ... und, selbstverständlich, menschliche Sprache.
Die folgende Abbildung repräsentiert die Zeitpunkte (t1, t2, t3, t4, t5, t5,
t6, ...) eines Knoten (im Zentrum), seine Nachbarn und die Nachbarn seiner
Nachbarn in einer multidimensionalen Vernetzung von Knoten. Wie zuvor
„schalten” sich, wenn sich ein Knoten „ausschaltet (weiß)”,
all seine Nachbarn (ein „rot”). Wenn n=4 repräsentiert die Abbildung
eine 4-D (D1, D2, D3, Dn) Vernetzung von Knoten mit je 8 klar gekennzeichneten
Möglichkeiten. (Wenn Dn Zeit repräsentiert, so könnte die Abbildung
eine 4-D Raum-Zeit Mannigfaltigkeit repräsentieren.) (Ich habe dieses Netzwerk
gebaut und es verhält sich wie beschrieben.)
(Eine 1-D (eindimensionale) Vernetzung von Knoten
bietet einem Beobachter einen paradoxen Kontext mit 2 Möglichkeiten an
jedem Knoten (2 Nachbarn); eine 2-D Vernetzung von Knoten, wie die, die wir zuvor
diskutiert haben, bietet an jedem Knoten 4 Möglichkeiten (4 Nachbarn); eine
3-D bietet 6; eine 4-D bietet 8; und eine n-D bietet 2n Möglichkeiten.
(Eine 0-D bietet keine).)
Um sich mehr als vier Dimensionen vorzustellen, muss sich der Leser die
zusätzlichen Knoten und deren Verbindungen zum Knoten im Zentrum zwischen
D3 und Dn und zwischen –D3 und –Dn vorstellen oder zeichnen, wie
in der Abbildung angedeutet.
Trotz dieser Zunahme an Komplexität oszilliert ein unbehindertes Netzwerk
individueller Elemente nach wie vor, ungeachtet der Komplexität ihrer Knoten,
der Signale oder ihres beobachteten Verhaltens sowie ungeachtet der Anzahl an
Dimensionen in denen sich ihre Interaktionen entfalten.
Die essenziellen Eigenschaften des 2-D Netzwerks haben sich nicht geändert:
es kann jede Form annehmen, seine Aktivität hat keine Grenzen, jede
Aktivität führt zu weiterer integrierter Aktivität. Es hält
lokalen und temporären Schäden stand, es kann mit anderen ähnlichen
Netzwerken interagieren und weitreichender oder permanenter Schaden kann die
Netzwerkaktivität als oszillierende Einheit zur Desintegration führen.
Wenn Ameisen ihre „Sprache” (Signale zwischen den Knoten) verlieren,
dann desintegriert die Aktivität des Ameisenhügels als Einheit. Dasselbe
wird Bienen und ihrem Bienenstock passieren. Und so wird es allen sozialen
Organismen (Menschen eingeschlossen) und ihren Gesellschaften passieren, wenn
sie ihre „Sprache” verlieren.
Beachten Sie jedoch, dass für eine komplexe Menge an Knoten wie etwa Menschen
in einer Gesellschaft eine präzise und/oder begrenzte „Sprache”
wie zum Beispiel die der Ameisen oder Bienen bereits einen Verlust darstellt.
Ein komplexes Individuum, das an sich bereits eine Einheit darstellt und nicht
vollkommen einer Gesellschaft unterworfen ist (so wie eine Ameise in einem
Ameisenhügel, eine Biene in einem Bienenstock etc.), benötigt eine
Gemeinschaft komplexer Individuen, die mit der Reichhaltigkeit und Flexibilität
interagiert, die notwendig ist, um das bestmögliche Leben für jedes
Individuum in der Gemeinschaft zu erreichen und zu erhalten.
Unglücklicherweise organisieren sich menschliche Gesellschaften in rigiden
Hierarchien, die die Vorhersehbarkeit (Trivialität) ihrer Mitglieder
benötigt, die somit rapide die Reichhaltigkeit und Flexibilität ihrer
Interaktionen verlieren, und sie zu trivialem Sprechen erniedrigt, das nicht
anders ist als die „Sprache” von Ameisen oder Bienen. Eine Gesellschaft
kann sich entwickeln, doch keine menschliche.
Hierarchien ersetzen Denken und Konversation mit Ritualen, seien sie säkular
oder religiös, so dass weder Denken noch Konversation stattfindet. Dies bringt
Gesellschaften hervor, denen die Gegenwart unbehaglich ist, mit Sehnsüchten
für eine primitive Vergangenheit und Vorahnungen einer Zukunft ohne Menschen.
Ein Entspannen der willkürlichen Unterscheidungen, die nötig sind um
hierarchische Gesellschaften zu etablieren und zu erhalten, in ausreichendem
Maß dass Hierarchien eliminiert werden, wird dementsprechend der Reichhaltigkeit
und Flexibilität von Interaktionen erlauben sich zu erholen und wieder
aufzublühen.
Vergegenwärtigen Sie sich das Netzwerk von Oszillatoren als eine Gemeinschaft
von Beobachtern mit einer nicht-hierarchischen Aktivität. Vergegenwärtigen
Sie sich die Störungen, die diese Aktivität beeinflussen, ohne sie zu
desintegrieren, die jedoch Stimulationen für unvorhersehbare Konflikte darstellen.
Die Flexibilität der nicht-hierarchischen Aktivität gestattet dem Netzwerk,
permanente Konflikte in einen neuen Tanz (Oszillation) einzubeziehen oder Konflikten
standzuhalten und seinen ursprünglichen Tanz wiederherzustellen.
Eine nicht-hierarchische Gemeinschaft individueller Beobachter benötigt keine
rigiden Unterscheidungen und wird daher ansonsten unlösbare Konflikte
bewältigen.
Paradoxes Denken
Dem logisch denkenden Beobachter sind Paradoxe unangenehm. Dieser Beobachter, der
von vornherein die meisten Möglichkeiten ausschließt, hält Paradoxe
für fehlerhaftes Denken. Daher zieht ein logisch denkender Beobachter
„logisches Denken” oder „paradoxes Denken” in Betracht.
Für einen paradox denkenden Beobachter zählen alle Möglichkeiten und
alle Möglichkeiten durchdringen einander. Für einen paradox denkenden
Beobachter durchdringen sich folglich „logisches” oder
„paradoxes” zu „logischem” und „paradoxem” Denken.
Ein lebender Organismus produziert und erhält sich selbst als geschlossenes
paradoxes Netzwerk von Prozessen und Komponenten, das sich selbst als Beobachter
einer Umwelt unterscheidet, der von eben dieser Unterscheidung hervorgebracht wird.
Ein lebender Organismus, als eine Zelle oder als ein mehrzelliger Organismus,
benötigt zum Überleben eine geeignete Umwelt. Er kann auch die Rolle
eines Prozessors spielen der, mit anderen ähnlichen Organismen interagierend,
einen Teil einer geschlossenen Kette von Prozessoren darstellen kann, der, auf
der Basis einer gegebenen oder selbst hergestellten geeigneten Umwelt, zu einem
neuen lebenden Organismus aus lebenden Organismen führen kann. Zum
Überleben muss dieser neue Organismus eine geeignete Umwelt für das
Überleben seiner konstituierenden Organismen sowie für deren Ersetzen,
sei es durch Reproduktion oder auf andere Weise, bereitstellen. Diese neuen
Umstände erfordern, dass die konstituierenden Organismen, wie von dem neuen
Organismus gefordert, ihre Unvorhersehbarkeit (ihr paradoxes Denken) zugunsten
ihrer Vorhersehbarkeit (ihres logischen Denkens) aufgeben.
Dies geschieht zum Beispiel Ameisen und Bienen, wenn sie sich dem Ameisenhügel
oder dem Bienenstock, dem neuen lebenden Organismus, unterordnen.
Lassen Sie uns kurz zur Metapher des Netzwerks aus Oszillatoren zurückkehren.
In Isolation oszilliert jeder Knoten uneingeschränkt, befähigt durch
seine interne paradoxe Schleife. Als Teil eines Netzwerks muss er jedoch, so wie
es die Logik des Netzwerks verlangt, entsprechend den von anderen Knoten
empfangenen Signalen, seine Oszillation mit anderen Knoten im Gleichschritt halten.
Die Aktivität eines Nervensystems benötigt, so wie die anderer Netzwerke,
das Vorhandensein miteinander verbundener Oszillatoren (in diesem Fall ein oder
mehrere Neuronen innerhalb einer oder mehrerer paradoxer Schleifen), die diese
Aktivität generieren und aufrecht erhalten. Auf diese Weise bilden die
Neuronen ein Netzwerk aus Oszillatoren, das als Nervensystem bezeichnet wird.
Anderenfalls würde die Aktivität des Nervensystems verschwinden und
mit ihr die vielen Möglichkeiten, die es lebenden Organismen bietet.
Die dreidimensionale Struktur des Nervensystems enthält unzählige
Neuronen mit unzähligen Verbindungen. Da jedes Neuron mit vielen weiteren
Neuronen verbunden ist, funktioniert das Nervensystem, ungeachtet seiner
dreidimensionalen Struktur und unabhängig von der Position von Neuronen
und von den Einschränkungen von 3D-Raum, auf multidimensionale Weise.
Dies eröffnet ihm das enorme Potential eine Vielzahl von Pfaden zu
aktivieren, inklusive denjenigen Pfaden, die durch das Involvieren von
Effektoren und Sensoren die Umwelt mit einbeziehen, kurzum alle Möglichkeiten
- so wie in einem paradoxen Kontext in dem ein Beobachter vorläufige
Unterscheidungen trifft, wie es für das Interagieren mit sich selbst und
mit der Umwelt erforderlich ist. Sensoren und Effektoren bieten eine erste
vorläufige Unterscheidung: Der Beobachter unterschieden von seiner Umwelt,
in der sie selbst und andere Beobachter existieren.
Ein Beobachter mit einem Nervensystem das potentiell so komplex ist wie das eines
menschlichen Kleinkindes, tritt in eine Welt ein, die bereits von anderen
menschlichen Beobachtern bewohnt und geformt ist.
Das Nervensystem von Kindern entwickelt sich durch Interaktionen mit ihren
Umgebungen und mit sich selbst, in denen sie alle Möglichkeiten in Betracht
ziehen, inklusive Emotionen, Empfindungen und andere Beobachter, wobei von
seinen Effektoren und Sensoren voller Gebrauch gemacht wird.
Die Aktivität des kindlichen Nervensystems bietet einen paradoxen Kontext
(alle Möglichkeiten), in dem sich ihr paradoxes und logisches Denken
entwickeln.
Andere Beobachter, einige gleichgültig, einige fürsorglich, werden die
Welt-Erkundung der Kinder anleiten. Einige werden ihr logisches Denken mit einer
begrenzten Sichtweise stimulieren, andere werden ihr paradoxes Denken mit all
seinen Möglichkeiten stimulieren. Viele werden versuchen, sie darin zu
instruieren, wie sie die Welt sehen. Alle werden die Kinder
beeinflussen und damit in unterschiedlichem Maß Erfolg haben.
Ein Kind das Glück hat wird sich sein paradoxes Denken lebendig erhalten
und wird dementsprechend in einem paradoxen Kontext alle Möglichkeiten
in Betracht ziehen, indem es durch unabhängiges Denken soweit wie nötig
vorläufige Unterscheidungen trifft. Dies wird zu einem Nervensystem
führen, das seine ursprüngliche Neugierde, Wissbegierde und
Fähigkeit eigenständige Gedanken zu haben für das ganze Leben dieses
menschlichen Beobachters erhält. Ein solcher Beobachter wird die menschliche
Gesellschaft nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen und bedacht und ohne
vorgefasste Ideen, Vorurteile oder Dogmen, welche nur aus logischem Denken
hervorgehen, zu dessen Verbesserung beitragen.
Ein Kind das weniger Glück hat wird sein paradoxes Denken zugunsten von
logischem Denken unterdrücken und ein Nervensystem entwickeln, das seine
ursprüngliche Neugierde, Wissbegierde und sein unabhängiges Denken
verlieren wird. Dieses Kind wird bestenfalls zu einem gleichgültigen
Mitglied der Gesellschaft heranwachsen, das den Nachwuchs instruiert anstatt
ihn zu bilden. Eine bedauernswerte Gesellschaft, von der die meisten Mitglieder
in logischem Denken versunken sind, wird dem Wiedereintreten erliegen das
bereits im Vorwort erwähnt wurde.
Bald nach ihrer frühen Kindheit entwickeln Menschen auch die Fähigkeit
ihre eigenen Aktionen und Gedanken zu reflektieren. Eine bedauernswerte
Gesellschaft unterdrückt diese Entwicklung durch beliebige Hierarchien,
die die Möglichkeiten des Nervensystems beschränken, so dass bald
all ihre Mitglieder diese Fähigkeit verlieren und vollkommen ignorant
gegenüber diesem Vakuum in anderen und in sich selbst leben.
Anstatt sich auf logisches Denken und auf die Suche nach einer „Wahrheit”
zu verlassen, schlägt der Tractatus vor, sich auf paradoxes Denken und auf
die Erkundung aller Möglichkeiten zu verlassen, wodurch logisches Denken in
einem neuen Licht erscheint.
So wie bei allen Paradoxen kann kein Beobachter den Tractatus oder einzelne
Propositionen darin ohne Trivialisierung und Verlust „erklären”.
Die Propositionen des Tractatus sagen, lehren oder erklären nichts; sie
zeigen. Sie laden Beobachter ein, der Bequemlichkeit der Trivialisierung
zu entkommen, mittels Bildung Alternativen zu erkunden und zu vermehren,
Paradoxe und Logiken einander durchdringen zu lassen und instruierten
Unterscheidungen zu entkommen. Diese Einladung anzunehmen erfordert Mut, da
der Tractatus viele gelobte Begriffe und Gewohnheiten zerstört, und sich
von gegenwärtiger „Zivilisation”, Lebensweise und Sprache entfernt.